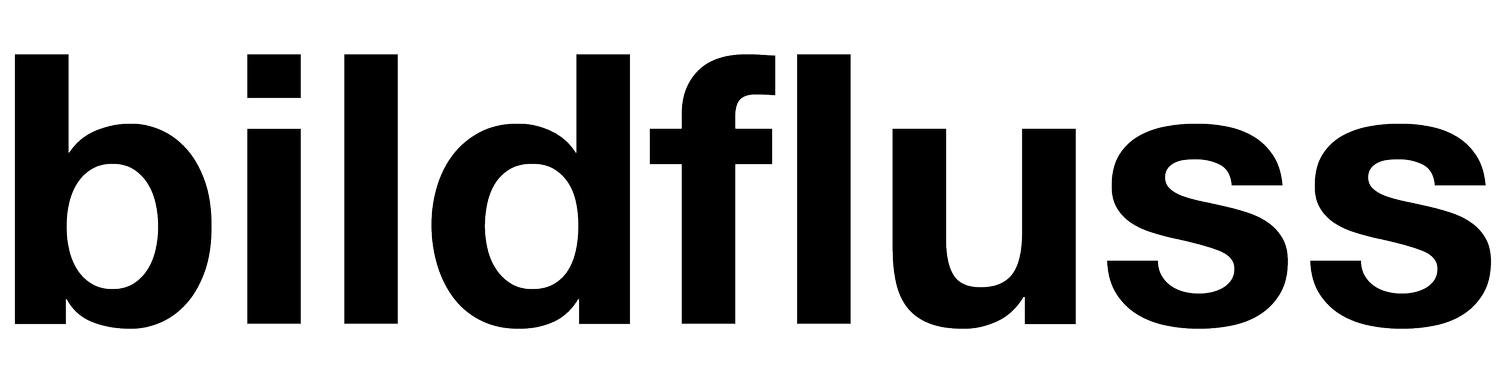Korporationen wohin?
Schweiz ein Land von Genossenschaften
Mit dem Buch «Die Verfassung der Allmende» wurde die amerikanische Umweltökonomin und Nobelpreisträgerin Elionor Ostrom weltberühmt. Sie kam bei ihren Forschungen zum Schluss, dass für eine nachhaltige Bewirtschaftung von lokalen Allmenden die zum Teil jahrhundertealten Korporationen in vielen Fällen staatlichen Organisation oder privaten Firmen überlegen sei.
Die Schweiz gilt als Paradebeispiel der genossenschaftlichen Kultur: «Wer verstehen will, warum es die Schweiz noch gibt,
muss ihre genossenschaftliche Geschichte kennen. Denn gemeinsamer Besitz und kollektiv genutzte Ressourcen haben das Land zusammengehalten», sagt der Forscher Daniel Schläppi vom Historischen Institut der Universität Bern. Das Prinzip des gemeinschaftlichen Wirtschaftens beschränkte sich aber nicht nur auf die Nutzung von Alpen und Wäldern: Genossenschaften bauten Trinkwasserversorgungen, Entwässerungsanlagen, Hochwasserverbauungen. Auch Handwerker, Säumer oder Schifffsleute organisierten sich genossenschaftlich.
Erfolgsgeschichte mit Schattenseiten
Die Genossen sorgten zu ihren Alpen und Wäldern mit dem pragmatischen Ziel das Gemeineigen gütlich zu verwalten und dauerhaft zu erhalten. Entscheidungen wurden von Gruppen getroffen und getragen. Die Genossen verstanden es aber den Kreis der Nutzniesser möglichst klein zu halten. Zuzüger, Hintersassen ohne Besitz, hatten keine Rechte und waren von der Nutzenung der Allmende weitgehend ausgeschlossen. Den armen Genossen war es oftmals beispielsweise gestattet auf der Allmende Obst und Nüsse zu ernten oder Kartoffeläcker und Gärten anzulegen. Die Nutzungsregeln wurden meistens in Abstimmungen festgelegt. Der politische Einfluss der Allmendgenossen beschränkte sich auf Allmendangelegenheiten. In den Regierungen sassen aber reiche, einflussreiche Familien.
Mit dem Einmarsch französischer Truppen 1798 begann die Zeit der Helvetischen Republik, ein Export der Französischen Revolution. Neben den Nutzungskorporationen, heute Bürgergemeinden, schufen die helvetischen Räte auf Gemeindeebene die «Einwohnergemeinden». Sie waren die ersten modernen Gemeinden auf dem Gebiet der Schweiz, in der alle Schweizer Bürger gleichberechtigt waren. Auch Tagelöhner, Hintersassen und Ausländer erhielten das Bürgerrecht. Nicht angetastet wurden die zahllosen Gemeinde-, Korporations- und Genossenschaftsgüter – Einerseits, weil mit starkem Widerstand zu rechnen war, andererseits, weil sie für das Funktionieren vieler Abläufe zu jener Zeit unentbehrlich waren.
Das Projekt SCALES
Das Projekt SCALES an den Universitäten Bern und Lausanne untersucht die Regulierung von kollektiven Ressourcen in der Schweiz von 1750 bis heute. HistorikerInnen, Sozialanthropologen, Humangeographen, Politologen und Agrarökonomen wollen anhand von fünf nationalen Fallbeispielen, in Chur, im Bleniotal, in Sarnen, im Val d’Anniviers und in Uri die Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Arten des kollektiven Ressourcenmanagements untersuchen. Wie gelingt es Genossenschaften das Gemeineigen zu verwalten und dauerhaft zu erhalten? Welches sind ihre Regelwerke? Welches sind ihre Anpassungsstrategien?
Tobias Haller, Professor für Sozialanthropologie an der Universität Bern: «Wichtig sind die Korporationen für die Entstehung und Erhaltung der Kulturlandschaft. Die Allmenden haben zudem einen hohen immateriellen und identitätsstiftenden Wert. Die staatlichen Entschädigungen für die Kulturlandschaftsleistungen in der Schweiz sind zwar weltweit einzigartig, suggerieren aber eine gefährliche Sicherheit. Der generelle Strukturwandel von der Agrar- hin zur Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft reduziert den Wert von Gütern aus kommunalrechtlichen Produktion. Heute haben landwirtschaftliche Produkte kaum mehr einen materiellen Wert.» Das heisst: Um die Allmenden, Alpen und Wälder in der Schweiz dauerhaft zu erhalten, braucht es die Bereitschaft der Bevölkerung und der Politik die Land- und Alpwirtschaft auch in Zukunft zu subventionieren und mitzutragen.
Einflussreiche Korporationen in Uri
Die Korporation Uri ist die grösste Landbesitzerin: 70 Prozent der Urner Kantonsfläche, 754 km2 Land, gehören der Korporation Uri. Ihre Geschichte reicht zurück ins 13. Jahrhundert. Aus verschiedenen lokalen genossenschaftlichen Organisationen, die Weiden und Wald nutzen, Wege und Stege bauen, entwickelte sich das Land Uri. Die Rechtssetzung über die Alpen und Wälder stand dem Land Uri zu, die oberste Gewalt lag bei der Landsgemeinde. Die Allmendgenossenschaft und das Land Uri waren eins, das heisst: nur Allmendgenossen waren Landleute und hatten politische Rechte.
Das 19. Jahrhundert wurde für Uri eine Zeit der grossen Umwälzungen. Die Eidgenössische Bundesverfassung von 1848 gewährte allen Schweizer Bürgern Niederlassungsfreiheit und Rechtsgleichheit, die Sonderstellung der Korporationsbürger entfiel. Die Aufgaben zwischen Kanton, Gemeinden und der Allmendgenossenschaft wurden mit der Kantonsverfassung von 1888 definitiv geregelt. Die Korporationen Uri und Ursern erhielten das Recht auf Selbstverwaltung und kümmern sich seither hauptsächlich um die Nutzung ihrer Alpen, Wälder und Gewässer.
Strukturwandel als grosse Herausforderung
Der Rückgang der Bauernbetriebe und die Entvölkerung des Urner Oberlands stellt die Korporation Uri vor neue Herausforderungen.
Sie reagiert mit verschiedenen Massnahmen: sie fördert die rationelle Bewirtschaftung der Urner Alpen. Sie unterstützt mit Beiträgen den Bau von zentralen Käsereien, Kleinkraftwerken, Wasserversorgungen, Alpgebäuden oder Erschliessungsstrassen. Sie ermöglicht den Auftrieb von grösseren Viehherden pro Alpbetrieb. Mit dem Kauf von Land im Talboden sichert sie wertvolles Kulturland für die Landwirtschaft. Mit gezielten Rodungen und dem Einsatz von Ziegen bekämpft sie die Einwaldung und Verbuschung ihrer Alpen. Aufgabe von Alpen, die Bedrohung von Schafherden durch Grossraubtiere oder Regeländerungen bei neuen Bewirtschaftungsformen, wie Mutterkuhalpen sind weitere Herausforderungen.
Staat im Staat?
«Die Korporation Uri muss sich heute vermehrt legitimieren, das heisst der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung beweisen, dass es sie heute noch immer braucht», sagt die Historikerin Rahel Wunderli, die innerhalb des Projekts SCALES das Fallbeispiel der Korporation Uri bearbeitet. «Der sinkende Anteil an Bauern und Bäuerinnen innerhalb der Korporation führt auch innerhalb der Korporation zu einer grösseren Durchmischung der Räte in beruflicher Hinsicht. Für die Korporation Uri bedeutet dies, dass sie über ihre bisherigen Hauptgeschäfte hinaus tätig sein muss, um ihre Existenz auch gegenüber diesen Bevölkerungsgruppen zu legitimieren. Sie tut dies in erster Linie mit Sponsoring im kulturellen Bereich. Ob und wie es gelingen kann, diesen gesellschaftlichen Trend mit dem bisherigen Kerngeschäft, nämlich der Verwaltung von Alpen und Wäldern zu kombinieren, wird für die Korporation Uri eine der wichtigsten Zukunftsfragen.»